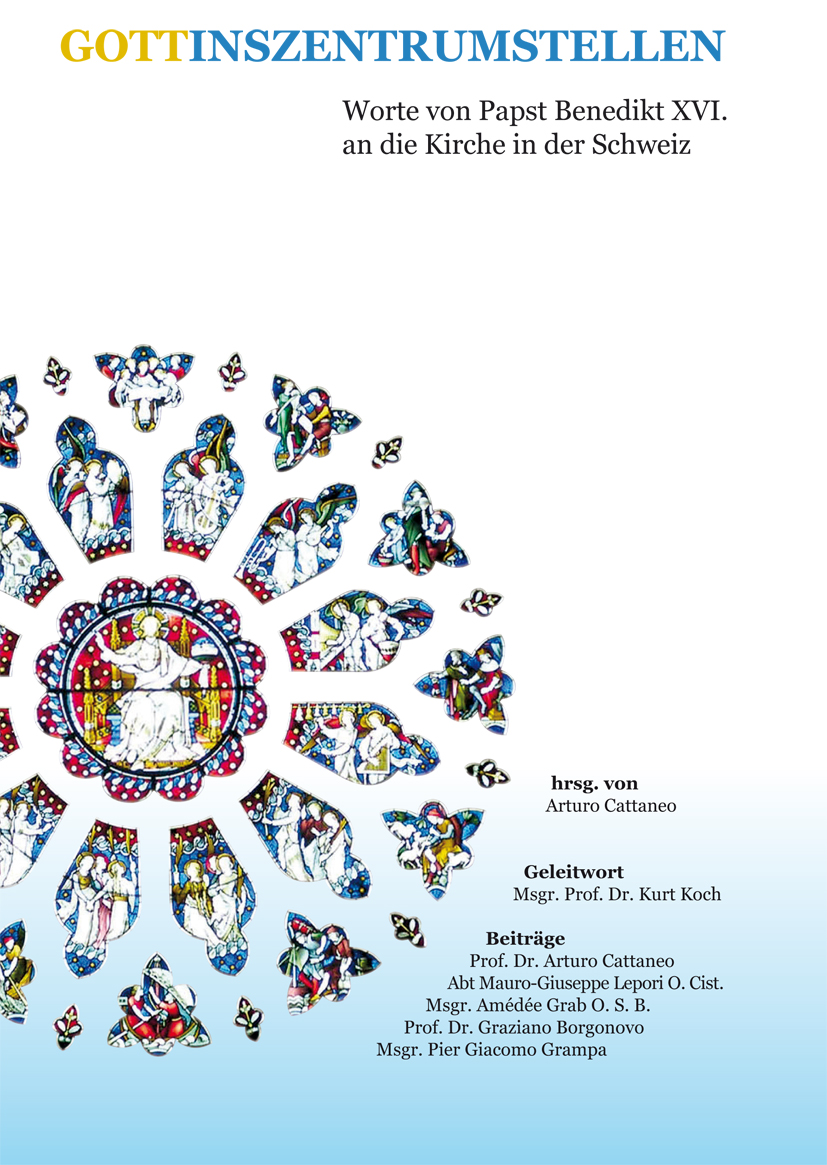GOTT INS ZENTRUM STELLEN Worte von Papst Benedikt XVI. an die Kirche in der Schweiz |
|
Die
großen Themen der Moralie Priorität des Glaubens |
|
|
Glaube und Moral. Der Glaube als «Weg» Der moralische Gehalt des Glaubens
«Wenn ich in den achtziger, neunziger Jahren nach Deutschland kam und um Inter-views gebeten wurde, wusste ich die Fragen immer schon im voraus. Es ging um Frauenordination, Empfängnisverhütung, Abtreibung und ähnliche Probleme, die ständig wiederkehren. Wenn wir uns in solche Diskussionen einfangen lassen, dann identifiziert man die Kirche mit einer Reihe von Geboten oder Verboten, und wir ste-hen da als Moralisten mit ein paar etwas altmodischen Ansichten, aber die eigentli-che Größe des Glaubens scheint gar nicht auf. Daher meine ich, ist es von grundle-gender Bedeutung, die Größe unseres Glaubens immer wieder herauszustellen, und davon dürfen wir uns durch solche Situationen nicht abbringen lassen.» So der Heili-ge Vater Benedikt XVI. in seiner Schlussansprache bei der Begegnung mit den Schweizer Bischöfen zum Abschluss ihres Ad-limina-Besuches. In den letzten Passa-gen dieser Ansprache bezieht sich der Papst auf die großen Themen der Moral. Um diese Themen und die Antwort, welche die Kirche darauf gibt, zu begreifen, muss man von der Größe unseres Glaubens ausgehen. Über die Größe unseres Glaubens tauschte sich Papst Benedikt kontinuierlich mit den Schweizer Bischöfen aus, in freier Formulierung und in gewohnt intellektuell-brillanter Art. Auch in diesem Band wird man dafür mehrfach Belege finden können. Während seiner Reise nach Bayern im September 2006 beschrieb er die Größe unse-res Glaubens wie folgt: «Der Glaube ist einfach. Wir glauben an Gott – an Gott, den Ursprung und das Ziel menschlichen Lebens. An den Gott, der sich auf uns Menschen einlässt, der unsere Herkunft und unsere Zukunft ist. So ist Glaube immer zugleich Hoffnung, Gewissheit, dass wir Zukunft haben und dass wir nicht ins Leere fallen. Und der Glaube ist Liebe, weil Gottes Liebe uns anstecken möchte. Das ist das erste: Wir glauben einfach an Gott, und das bringt mit sich auch die Hoffnung und die Lie-be. Als zweites können wir feststellen: Das Glaubensbekenntnis ist nicht eine Summe von Sätzen, nicht eine Theorie. Es ist ja verankert im Geschehen der Taufe – in einem Ereignis der Begegnung von Gott und Mensch. Gott beugt sich über uns Menschen im Geheimnis der Taufe; er geht uns entgegen und führt uns so zueinander. Denn Taufe bedeutet, dass Jesus Christus uns sozusagen als seine Geschwister und damit als Kinder in die Familie hinein adoptiert. So macht er uns damit alle zu einer großen Familie in der weltweiten Gemeinschaft der Kirche. Ja, wer glaubt, ist nie allein» (Predigt während der Messe vom 12. September 2006). Von den vielen Stellen der Enzyklika Deus caritas est, an denen die Größe unseres Glaubens ihrem Wesen nach beschrieben wird, mag es hier genügen, den folgenden Abschnitt wiederzugeben, der sie in ihrer unaufhebbaren Originalität und persönli-chen Qualität charakterisiert: «Das eigentlich Neue des Neuen Testaments sind nicht neue Ideen, sondern die Gestalt Christi selber, der den Gedanken Fleisch und Blut, einen unerhörten Realismus gibt. (…) In seinem Tod am Kreuz vollzieht sich jene Wende Gottes gegen sich selbst, in der er sich verschenkt, um den Menschen wieder aufzuheben und zu retten – Liebe in ihrer radikalsten Form. Der Blick auf die durch-bohrte Seite Jesu (…) begreift, was Ausgangspunkt dieses Schreibens war: ,,Gott ist Liebe’’ (1Joh 4,8). Dort kann diese Wahrheit angeschaut werden. Und von dort her ist nun zu definieren, was Liebe ist. Von diesem Blick her findet der Christ den Weg sei-nes Lebens und Liebens» (Nr. 12). Und beim Angelus zu Beginn der Fastenzeit am 25. Februar 2007 fügte er hinzu: «Möge die Menschheit erkennen, dass nur aus die-ser Quelle die spirituelle Energie geschöpft werden kann, die unentbehrlich ist für den Aufbau von Frieden und Glück, wonach jeder Mensch unaufhörlich sucht». Glaube und Moral. Der Glaube als «Weg» Wenn die Moral als ein Gesamt von Verboten und Geboten angesehen wird, deren Grund man nicht mehr begreift, dann ist es klar, dass sie traurig wird. Sie wird zu einer schweren Last, von der man sich befreien will. Aber eine solche Auffassung, de-ren Unangemessenheit wir sogleich sehen werden, könnte man dann leicht auf das Glaubensgut selbst ausdehnen. Der damalige Kardinal Joseph Ratzinger beschreibt anhand einer persönlichen Erfahrung, die sehr zutreffend das Thema der angeblichen Rechtfertigungskraft des irrenden Gewissens berührt, die Wurzel des moralischen Problems im Fluss der menschlichen Existenz. Der Umfang des Zitats ist durch seine Bedeutsamkeit gerechtfertigt. «Es kam mir zum ersten Mal mit seiner ganzen Dringlichkeit in der Anfangszeit mei-ner akademischen Wirksamkeit vor die Augen. Ein älterer Kollege, dem die Not des Christseins in unserer Zeit auf der Seele lag, äußerte damals in einem Disput die Mei-nung, man müsse eigentlich Gott dankbar sein, dass er so vielen Menschen schenke, guten Gewissens ungläubig zu werden. Denn wenn ihnen die Augen aufgingen und sie gläubig würden, wären sie nicht imstande, in dieser unserer Welt die Last des Glaubens und seine moralischen Verpflichtungen zu ertragen. Nun aber, da sie guten Gewissens einen anderen Weg gingen, könnten sie dennoch zum Heil gelangen». Die Antwort des zukünftigen Papstes auf diese eigensinnige Überlegung kommt sofort und ohne Zögern: «Was mich an dieser Behauptung schockierte, war zunächst nicht die Idee eines von Gott selbst gegebenen irrigen Gewissens, um mit dieser List die Menschen retten zu können, sozusagen die Idee einer von Gott zum Heil der Betref-fenden geschickten Verblendung. Was mich störte, war die Vorstellung, dass danach der Glaube eine kaum zu ertragende und wohl nur für starke Naturen zu meisternde Last wäre, beinahe eine Art Strafe, jedenfalls eine Zumutung nicht leicht zu bewälti-gender Art. Er würde danach das Heil nicht erleichtern, sondern erschweren. Froh sein müsste demnach, wem nicht aufgebürdet wird, glauben zu müssen und sich dem Joch der Moral des Glaubens der katholischen Kirche zu beugen. Das irrige Gewissen, das einen leichter leben lässt und einen menschlicheren Weg zeigt, wäre dann die eigentliche Gnade, der normale Weg zum Heil. Die Unwahrheit, das Fernbleiben der Wahrheit, wäre dem Menschen besser als die Wahrheit; nicht die Wahrheit würde ihn befreien, sondern von ihr müsste er befreit werden. Der Mensch wäre besser im Dunkel zu Hause als im Licht; der Glaube nicht gutes Geschenk des guten Gottes, sondern eher ein Verhängnis». Von daher die weiteren rhetorischen Fragen und Be-merkungen: «Wie sollte, wenn es so steht, Freude am Glauben aufkommen? Wie gar der Mut, ihn anderen weiterzugeben? Wäre es dann nicht besser, andere damit zu verschonen oder gar sie davon abzuhalten? Vorstellungen dieser Art haben in den letzten Jahrzehnten zusehends die Bereitschaft zur Evangelisierung gelähmt: Wer den Glauben als schwere Last, als moralische Zumutung sieht, mag andere nicht dazu einladen; er lässt sie besser in der vermeintlichen Freiheit ihres guten Gewissens» . Die christliche Moral kann nicht eigene Wege beschreiten, die unabhängig vom Weg des Glaubens wären. Die Größe des Glaubens zeigt der Moral ihren eigenen Weg. Man würde in einer Sackgasse landen, wenn man beim Aufbau der Moral von der Größe des Glaubensweges absähe. Der gelebte Glaube als Begegnung mit Christus macht nicht traurig, sondern er erweitert das Herz und den Geist. Er erweitert die Vernunft. Genau hierin besteht die großherzige Einladung, die Papst Benedikt XVI. in seiner Vorlesung an der Universität Regensburg am 12. September 2006 an alle rich-tete: «Mut zur Weite der Vernunft, nicht Absage an ihre Größe (…) In diesen großen Logos, in diese Weite der Vernunft laden wir beim Dialog der Kulturen unsere Ge-sprächspartner ein». Wenn man hingegen in einer aus dem Nominalismus hervorge-gangenen modernen, subjektivistischen Kultur die Moral auf das äußere Gesetz redu-ziert, und wenn man die grundsätzliche Ausrichtung der Vernunft und des menschli-chen Willens auf das Wahre und Gute in Abrede stellt (das sind dann die Sackgas-sen!), dann nimmt man zu oft an, sowohl im gegenwärtig verbreiteten Alltagsdiskurs als auch in der akademischen Diskussion, dass zwischen Gesetz und Freiheit ein ra-dikaler, unheilbarer Konflikt herrscht. Gegenüber einer Auffassung von Freiheit als «reiner Autonomie» (oder raffinierter formuliert: als «Wert schöpferische Freiheit») würde sich ein angeblich begrenzender Anspruch der Gebote Gottes erheben. In einer solchen Vorstellung stehen sich Freiheit und Gesetz wie zwei Kämpfer auf dem Schlachtfeld gegenüber. Für die gesamte patristische und mittelalterliche christliche Tradition sowie für eine vom Realismus geprägte Philosophie, wie sie etwa vom hl. Thomas von Aquin brillant zusammengefasst wurde, steht indessen fest, dass man an der Wurzel der Freiheit der Vernunft begegnet, welche von Natur aus zum Wahren drängt. Auf dem Weg dahin fungiert das Gesetz als Führer und sichere Stütze, so wie die übernatürliche Gnade dem Willen unerlässliche Hilfe gewährt. Daher versteht man, um es mit Worten der Enzyklika Veritatis splendor von Papst Johannes Paul II. zu sagen, weshalb «die Liebe und das Leben nach dem Evangelium (…) nicht zuerst in der Gestalt des Gebots gedacht werden dürfen; denn das, was sie verlangen, geht über die Kräfte des Menschen hinaus: Sie sind nur möglich als Frucht einer Gabe Gottes, der durch seine Gnade das Herz des Menschen heil und gesund macht und es umgestaltet» (Nr. 23). Eine solche Heilung und Umgestaltung erzeugt neues Leben, welches selbst von innen heraus, aus dem Weg des Glaubens heraus, ein neuen Denken zu erzeugen vermag. «Der Glaube ist nicht reine Theorie; er ist vor allem ein „Weg“, also eine Praxis. Die neuen Überzeugungen, die er bietet, haben ei-nen unmittelbar praktischen Gehalt. Der Glaube schließt die Moral mit ein, und das sind nicht nur allgemeine Ideale. Er bietet viel mehr: konkrete Hinweise für das menschliche Leben. Gerade durch ihre Moral unterschieden sich die Christen von den anderen Menschen in der Antike; eben auf diese Weise wurde ihr Glaube als et-was Neues sichtbar, eine unverwechselbare Wirklichkeit. Ein Christentum, das nicht mehr ein gemeinsamer Weg wäre, sondern nur mehr vage Ideale verkündete, wäre nicht mehr das Christentum Jesu Christi und seiner unmittelbaren Jünger. Deshalb ist es ein bleibender Auftrag der Kirche, eine Lebensgemeinschaft zu sein und kon-kret den Weg des rechten Lebens aufzuzeigen. (…) Die Kirche, die eben von ihrer ur-eigensten Natur ausgeht, muss unablässig „den Weg zeigen“. Sie muss den morali-schen Gehalt des Glaubens immer wieder neu sichtbar machen» . Der moralische Gehalt des Glaubens a) In seiner Schlussansprache an die Schweizer Bischöfe erwähnt der Papst die zwei großen Bereiche, in welche die Moral heutzutage unterteilt zu sein scheint. Auf der einen Seite ist sie der gegenwärtigen, relativistischen Mentalität völlig gegenläufig: Dies betrifft die Verteidigung des Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod und die monogame, auf der Ehe gegründete Familie. Auf der anderen Seite ist sie starken ideologischen Verkürzungen ausgesetzt: Dies betrifft Themen wie Frieden, Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit für alle, Sorge um die Armen und Respekt vor der Schöpfung. Zu diesem «sozialen» Aspekt bemerkt Benedikt XVI.: «Er ist zu einem Ensemble von Moral geworden, das gerade als politische Kraft sehr mächtig ist und für viele eigentlich den Ersatz oder die Nachfolge der Religion darstellt. An die Stelle der Religion, die als Metaphysik, als jenseitig und vielleicht auch als etwas Individua-listisches gilt, treten die großen moralischen Themen als das Eigentliche, das dem Menschen dann Würde gibt und ihn auch fordert. (…) Die Mittel, die man als Lösun-gen anbietet, sind dann oft sehr einseitig und nicht immer glaubwürdig…». Hier kommen mir die in mancher Hinsicht prophetischen Worte von Vladimir Solov-jev, des größten orthodoxen russischen Philosophen des 19. Jahrhunderts, in den Sinn. In der Kurzen Erzählung vom Antichrist, die später als sein geistliches Testa-ment angesehen werden sollte, schreibt er im Hinblick auf den «Menschen der Zu-kunft»: «Christus, der das sittlich Gute predigte und in seinem Leben darstellte, war der Besserer der Menschheit, ich aber bin berufen, der Wohltäter dieser teils gebes-serten, teils aber unverbesserlichen Menschheit zu sein. Ich werde den Menschen alles geben, was sie brauchen. Als Moralist trennte Christus die Menschen durch die Unterscheidung von Gut und Böse, ich werde sie vereinigen durch die Güter, deren Gute und Böse in gleicher Weise bedürfen. Ich werde der wirkliche Vertreter des Got-tes sein, der seine Sonne aufgehen lässt über die Guten und über die Bösen und reg-nen lässt über Gerechte und Ungerechte. Christus brachte das Schwert, ich bringe den Frieden. Er drohte der Erde mit dem schrecklichen jüngsten Gericht, aber der letzte Richter werde ja ich sein, und mein Gericht wird nicht ein Gericht der bloßen Gerechtigkeit, sondern ein Gericht der Gnade sein. Auch Gerechtigkeit wird in mei-nem Gericht sein, aber keine vergeltende Gerechtigkeit, sondern eine verteilende Ge-rechtigkeit. Ich unterscheide sie alle und gebe jedem das, was er braucht» . Die Macht der Welt, der Kaiser braucht – gerade wegen des Anspruchs auf absolute und unbestrittene Herrschaft im Blick auf das diabolische Projekt von Friedenssicherung, Gemeinwohl und universalem Wohlstand – den Dienst der Kirche. Eine Kirche, die nun zu einer Art geistlicher und moralischer Assistentin der Macht wird, um die Spal-tung und das radikale Unglück des Menschen zu «überdecken», ohne sie wirklich heilen zu können. Kardinal Giacomo Biffi, der emeritierte Erzbischof von Bologna, sprach anlässlich der Exerzitien für den Papst und die Kurie (vom 26. Februar bis 3. März 2007) auch von Solovjev und seiner Kurzen Erzählung vom Antichrist. Deutlich erklärte er: «Die Lehre, die uns der große russische Philosoph hinterlässt, besagt, dass das Christen-tum nicht auf ein Gesamt von Werten reduziert werden kann. Im Zentrum christli-chen Daseins steht in Wirklichkeit die persönliche Begegnung mit Jesus Christus». In dieser Reduzierung besteht wohl bemerkt «die Gefahr, welcher die heutigen Christen ausgesetzt sind», weil «der Sohn Gottes sich nicht in eine Reihe guter, an die domi-nierende weltliche Mentalität angepasste Projekte überführen lässt». Und weiter prä-zisierte er: «All das bedeutet keine Verurteilung der Werte, die freilich auch dem auf-merksamen Unterscheidungsvermögen anheim gestellt sind. Es gibt in der Tat abso-lute Werte wie das Gute, das Wahre, das Schöne. Wer sie wahrnimmt und sie liebt, der liebt auch Christus, selbst wenn er es nicht weiß, weil Christus die Wahrheit, die Schönheit und die Gerechtigkeit ist». Und «es gibt relative Werte wie die Solidarität, die Friedensliebe und den Respekt der Natur. Wenn diese absolut gesetzt werden und sich von ihrer Wurzel lösen oder sich sogar der Botschaft der Erlösungstat entgegen-stellen, dann verleiten sie zum Götzendienst und behindern den Weg des Heils». Die Auffassung von menschlicher Person, die den unterschiedlichen sozialen und po-litischen Projekten zugrunde liegt, ist in Wirklichkeit immer etwas Entscheidendes und Unterscheidendes. In seiner Botschaft zum Weltfriedenstag vom 1. Januar 2007, mit dem emblematischen Titel Der Mensch – Herz des Friedens, stellt Benedikt XVI. fest: «Heute ist jedoch der Friede nicht nur in Frage gestellt durch den Konflikt zwi-schen den verschiedenen verkürzten Menschenbildern bzw. Ideologien, sondern auch durch die Gleichgültigkeit gegenüber dem, was die wahre Natur des Menschen ausmacht. Viele Zeitgenossen leugnen nämlich die Existenz einer spezifischen menschlichen Natur und ermöglichen so die verschrobensten Interpretationen des-sen, was wesentlich zum Menschen gehört. Auch hier bedarf es der Klarheit: Eine „schwache“ Sicht des Menschen, die jeder auch exzentrischen Vorstellung Raum gibt, begünstigt nur scheinbar den Frieden. In Wirklichkeit behindert sie einen echten Dialog und öffnet dem Dazwischentreten autoritärer Zwänge den Weg. So lässt sie schließlich den Menschen selbst schutzlos dastehen, und er wird zur einfachen Beute von Unterdrückung und Gewalt» (Nr. 11). Wenn «Christus unser Friede ist» (vgl. Eph 2,14), und wenn sich tatsächlich «nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wor-tes das Geheimnis des Menschen wahrhaft aufklärt» (Gaudium et Spes, 22), dann ist es objektiv nicht möglich, an den Frieden, den das Herz eines jeden Menschen bren-nend wünscht, sowie an alle konstitutiven Bedürfnisse des unbegrenzt wünschenden menschlichen Herzens zu denken und dabei vom objektiven Bezug auf Christus abzu-sehen. Denn Er ist die Größe unseres Glaubens, ein unverzichtbarer Schatz auch und gerade für die Verteidigung des Menschen und seiner Würde. b) «Nur wenn das menschliche Leben von der Empfängnis bis zum Tod geachtet wird, ist auch die Friedensethik möglich und glaubhaft; nur dann kann die Gewaltlo-sigkeit ganzheitlich werden, nur dann nehmen wir die Schöpfung wirklich an und nur dann kann es zu wahrer Gerechtigkeit kommen». So Benedikt XVI. an die Schweizer Bischöfe. Und weiter: «Wir müssen uns darum mühen, die beiden Hälften der Moral wieder zusammenzubringen und deutlich zu machen, dass sie untrennbar zueinander gehören». Ohne einen rechten Begriff der menschlichen Person, wonach die Grund-rechte so anerkannt werden, dass sie von Natur aus zur absoluten Einmaligkeit des Seins gehören – wobei das Recht auf Leben offensichtlich grundlegend bezüglich aller anderen Rechte ist –, läuft jedes sonstige «soziale» oder «ökologische» Projekt Ge-fahr, sich Logiken zu unterwerfen, die zumindest partiell sind. Worauf kann man bei diesem Wiederaufbau der Moral zurückgreifen, wo doch heute so viele Hindernisse im Wege stehen? Sicher auf das, was die Größe unseres Glaubens ausmacht. Sicher auf das, was die Enzyklika Evangelium vitae so ausdrückt: «Selbst in Schwierigkeiten und Unsicherheiten vermag jeder Mensch, der in ehrlicher Weise für die Wahrheit und das Gute offen ist, im Licht der Vernunft und nicht ohne den geheimnisvollen Einfluss der Gnade in dem ins Herz geschriebenen Naturgesetz (vgl. Röm 2,14-15) den heiligen Wert des menschlichen Lebens vom ersten Augenblick bis zu seinem Ende zu erkennen» (Nr. 2). Sicher auch auf einen umfassenden Begriff von Erzie-hung und Erziehern, die, um es noch einmal mit Papst Benedikts Worten aus seiner Eröffnungsansprache zu sagen, «zu einem intelligenten Glauben erziehen sollen, so dass Glaube Intelligenz und Intelligenz Glaube wird». Wenn «die Bildung eines wahren – weil auf der Wahrheit gegründeten – und eines rechten Gewissens – weil dazu entschlossen, den Geboten der Wahrheit wider-spruchslos, getreu und kompromisslos zu folgen – heute ein schwieriges und delika-tes, aber unverzichtbares Unterfangen ist» , dann ist «das Naturrecht (…) schließlich das einzige gültige Bollwerk gegen die Willkür der Macht oder die Täuschungen der ideologischen Manipulation» . Es ist wahr, dass die modernen Moralisten im allge-meinen sehr deutlich die Pflicht hervorgehoben haben, aufrichtig und getreu der Stimme des Gewissens zu folgen. Ganz zu Recht! Mit der gesamten christlichen Tra-dition vor ihm fordert dies der hl. Thomas nicht weniger entschlossen; aber er fügt immer hinzu, was heute leider oft vergessen wird, dass man vorab eine große Liebe für die Wahrheit selbst braucht. Das Problem der Wahrheit besteht für das Gewissen nicht zunächst im Einklang mit sich selbst, im Aufrichtig- oder Überzeugtsein. Zu-nächst und wesentlich geht es um die Übereinstimmung mit der objektiven Ordnung der Dinge, wie sie sich als definitiver Reflex des ewigen göttlichen Gesetzes im Natur-recht zeigt. c) Im Einsatz für das Leben, also für dessen Verteidigung gegen die Abtreibung, die Euthanasie, die genetische Manipulation und, im selben Kontext, im Einsatz für die auf der Unauflöslichkeit der Ehe gegründeten Familie, «stößt unsere Verkündigung auf ein gegenläufiges Gesellschaftsbewusstsein», das sich, so der Papst, «auf einen Begriff der Freiheit als des Allein-selber-wählen-Könnens» stützt. Freiheit der Wahl, Wahlfreiheit des Gewissens, ja sogar Wahl des Glaubens. Ohne ausführlich zu werden, lohnt es sich doch zu präzisieren, dass der Ausdruck «Wahl des Glaubens» nicht zum traditionellen kirchlichen Sprachgebrauch gehört. Dieser qualifiziert die Antwort des Menschen auf das göttliche Geschenk des Glau-bens als einen Akt. Der Glaube als Akt ist mit den Worten des Katechismus der Ka-tholischen Kirche «eine persönliche Bindung des Menschen an Gott und zugleich, untrennbar davon, freie Zustimmung zu der ganzen von Gott geoffenbarten Wahr-heit» (Nr. 150). Deshalb findet der freie Akt der Wahl seine eigentlich angemessene Stellung im Innern der komplexen Dynamik von Bindung und Zustimmung. Den zitierten Formeln begegnet man in unseren Tagen immer wieder. Die Kategorie der Wahlfreiheit taucht in der gegenwärtigen Gesellschaft in beliebigem Umfeld fast zwanghaft immer wieder auf. Es ist wichtig, über die Wahlfreiheit – dieses «Totem», vor dem sich alle ehrfurchtsvoll verneigen – von neuem nachzudenken, über die Na-tur und die Wechselbeziehungen dessen, was zweifellos ein fundamentaler Akt des Willens ist. Dabei muss man nicht notwendigerweise und a priori annehmen, es sei «das, vor dem nichts existiert». Denn genau das wäre Nihilismus – die Annahme, die Wahlfreiheit sei das, vor dem nichts existiert («ohne vordefinierte Orientierungen autonom wählen zu können») – die heute vorherrschende Philosophie, welche sogar die Möglichkeit, über das, was Wahlfreiheit ist, nachzudenken zu können, zum Schei-tern verurteilt, weil sie schon zum voraus davon ausgeht, dass die Wahlfreiheit die Möglichkeitsbedingung der Existenz der Wirklichkeit ist. Die tägliche Erfahrung der Wahlfreiheit bezeugt indes eindeutig, dass diese Wahl-freiheit nicht „an-archisch“, nicht ohne Ursprung, ist. Sie wurzelt vielmehr in einer vorhergehenden, tieferen Absicht. Sie verifiziert sich immer auf Grund von etwas. Diese Ausrichtung auf das für die eigene Person Gute (das wahre oder als solches an-genommene Gute), also die Erwartung der Erfüllung ist eben die vorgängige, not-wendige Bedingung für die Existenz selbst der freien Wahl. Die Wahl, sei es in Bezug auf das Ziel, sei es in Bezug auf die Verwendbarkeit für das Gute (das wahre oder als solches angenommene Gute), ist nicht «das, vor dem nichts existiert». Die Freiheit ist mehr als bloß Wahlfreiheit. Aus der Vernunft erhält die Freiheit ihre spezifisch menschliche Würde und ihre Zielgerichtetheit, die sie von Natur aus unterscheidet. Durch den Vernunftgebrauch nimmt der Mensch an jener Weisheit teil, die in seine persönliche Natur eingeschrieben ist und die er ursprünglich erhalten hat. Genau das ist das Naturrecht. Ein solcher bewusster Gebrauch der Vernunft ist die größtmögli-che Freiheit. Jeder muss in den verschiedenen Bereichen und aus persönlicher Verantwortung den Hinweis von Papst Benedikt aufnehmen, den er zum Abschluss des Besuches der Schweizer Bischöfe beim Nachfolger Petri äußerte. Es geht einerseits darum, «das Christentum nicht als bloßen Moralismus erscheinen zu lassen, sondern als Gabe, in der sich uns die Liebe schenkt, die uns trägt», und andererseits «in diesem großen Kontext der geschenkten Liebe dann auch zu den konkreten Folgerungen zu schrei-ten». Denn der Glaube ist, wie man auch in diesem kurzen Beitrag beobachten konn-te, Weg zum Leben; die Kirche hat ihrerseits die unumgängliche Aufgabe, den Weg des rechten Lebens aufzuzeigen. Christus nachfolgen, der uns das gute Antlitz des alle Dinge schaffenden, ewigen Ge-heimnisses gezeigt hat, ist also die grundlegende, historische Herausforderung für das menschliche Gewissen. Dadurch soll ihm der spezifische Platz jenseits aller mög-lichen Täuschungen und Irrtümer zurückgegeben werden, der ihm von der göttlichen Vorsehung zugewiesen wurde: mit dem Urteilsvermögen der Vernunft die morali-schen Entscheidungen zu orientieren, indem das Gute geliebt und das Böse gemieden wird. Und wie der Glaube an Christus das Gewissen in seiner absoluten Würde ver-herrlicht, so erlangt das Gewissen nur dann die volle Wahrheit, welche das Gewissen ja von Natur aus charakterisiert, wenn sie sich Dem hingibt, der sie schuf, ihr entge-geneilte und so vollendete. Gott hat am Anfang der Zeiten den Menschen mit dem natürlichen Licht des Gewissens erleuchtet, um ihn anhand des Guten zu morali-schen Entscheidungen zu führen, die er fortan treffen sollte. Schließlich hat er ihm «in der Fülle der Zeiten» in der Person seines menschgewordenen Sohnes die defini-tive Antwort gegeben, was für das Leben gut und was böse ist. Christus selbst wird «zum lebendigen und persönlichen Gesetz» (Enzyklika Veritatis splendor, 15) einer vollendeten menschlichen Existenz. Das Christentum wurde dem Menschen wahrhaft als «Synthese von Glaube und Ver-nunft» gegeben! «Vielleicht der schönste und bündigste Ausdruck dieser neuen christlichen Synthese findet sich in einem Bekenntniswort des ersten Johannesbriefs: „Wir haben der Liebe geglaubt“ (1Joh 4,16). Christus war für diese Menschen zur Entdeckung der schöpferischen Liebe geworden; die Vernunft des Weltalls hatte sich als Liebe offenbart – als jene größere Rationalität, die auch das Dunkle und Irrationa-le in sich aufnimmt und heilt» . Deshalb werden sie «auf den schauen, den sie durch-bohrt haben (Joh 19,37), denn «fürwahr nur die Liebe, in der sich die kostenlose Selbsthingabe und der leidenschaftliche Wunsch nach Gegenseitigkeit vereinen, ge-währt eine Trunkenheit, welche die schwersten Opfer leicht macht» . |
|