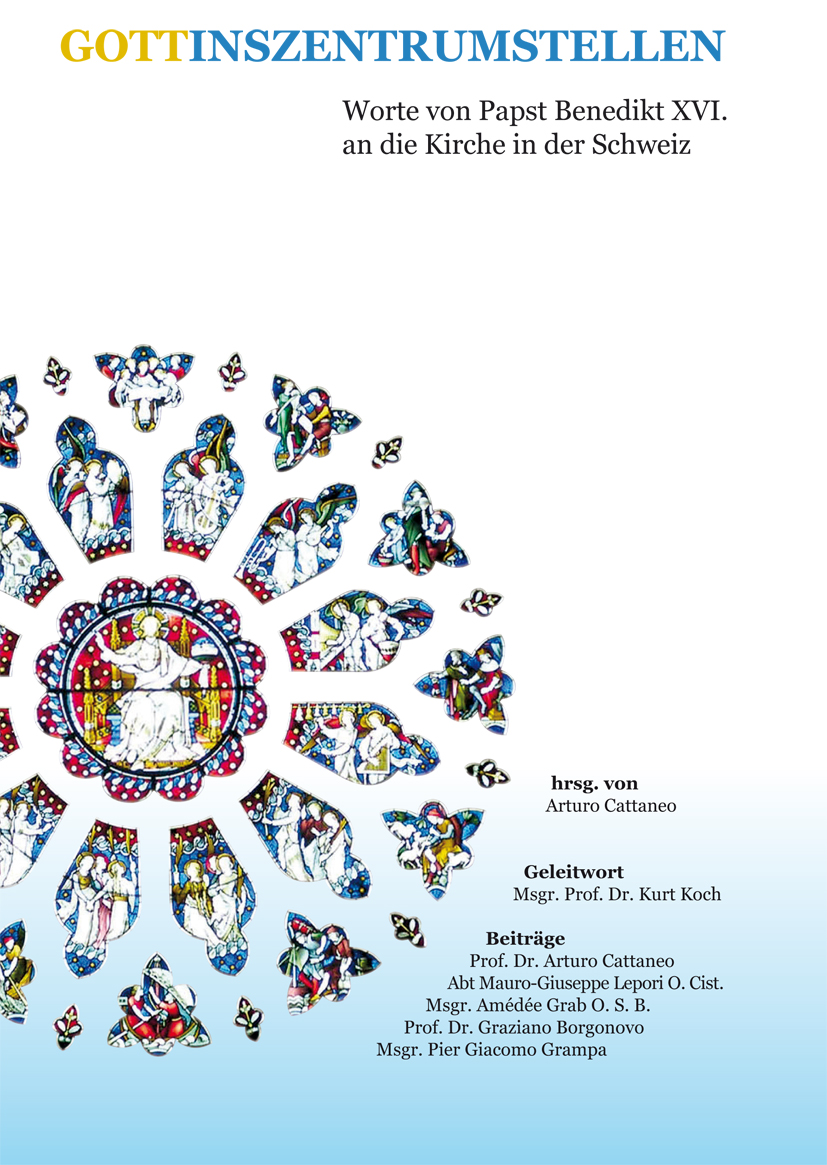Die
Bedeutung der persönlichen Beziehung zu Gott
„Ich bin mit dir“
Am
Anfang steht eine völlig unverdiente Einladung
Die
verschmähte Einladung
Der
Weg der Erneuerung: bei der Erfahrung Gottes anfangen
Beten
lernen und lehren
Für
ein frohes Christentum: die Hoffnung
Die
Bedeutung der persönlichen Beziehung zu Gott
„Ich bin mit dir“
Beim Lesen der Predigt
und der Ansprachen, die der Papst anlässlich des Ad-limina-Besuches
der Schweizer Bischöfe im November 2006 gehalten hat, kam mir die
Szene der Berufung des Mose (Ex 3,7-12) in den Sinn. Der Herr erscheint
Mose im bren-nenden Dornbusch und offenbart ihm sogleich den Grund,
warum er sich zeigt: «Ich habe das Elend meines Volkes gesehen … Ich
bin herabgestiegen, um es zu befreien …». Und unverzüglich gibt Gott
einen Auftrag, wie wenn er einen Pfeil abschießen würde, der bei der
geringsten Abweichung sein Ziel verfehlt: «Und jetzt geh! … Führe
mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus!» Dieser Auftrag wird
zur Berufung des Mose. Mose weiß um seine Unzulänglichkeit, er erfasst,
wie sehr diese Sendung seine Fähigkeiten übersteigt und er führt Gott
seine Schwachheit vor Augen: «Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen
und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte?» Der Ruf, der
Gott an ihn richtet, stürzt ihn in eine radikale Identitätskrise.
Mose weist ja nicht in erster Linie auf den Mangel an Kraft und Fähigkeit
hin, sondern vielmehr auf die Haltlosigkeit seines «Ich», auf die
Bedeutungslosigkeit seiner Person, auf die Armseligkeit seiner Identität:
«Wer bin ich?» Es fehlen ihm zur Ausführung des gött-lichen Auftrages
nicht so sehr die Mittel: Er selbst ist der Mangel, gerade seine Per-son
ist nicht angemessen, nicht die richtige.
Da sagt Gott ihm nicht: «Bleib nur ruhig, du wirst es schon schaffen,
du hast die nöti-gen Eigenschaften, hab Selbstvertrauen!» Gott sagt
nur: «Ich bin mit dir!» (Ex 3,12).
Es ist, als würde Benedikt XVI. das Gleiche zu den um ihn versammelten
Schweizer Bischöfen sagen, als er sie in ihrer Berufung und Sendung
als Hirten bestärken woll-te, als Hirten des Volkes des einundzwanzigsten
Jahrhunderts, eines Volkes, das die wahre Freiheit zu verlieren, das
auf die Freiheit des Denkens, des Handelns, der ech-ten Liebe zu verzichten
scheint. Jesus Christus sendet auch heute seine Apostel, seine Jünger
zu den Menschen unserer Zeit. Diese Menschen sind nicht mehr vom ägypti-schen
Pharao, sondern von heimtückischeren Mächten und Ideologien beherrscht.
Wer diese Sendung heute erhält, wird in die Verwirrung des Mose, die
sein Selbstbe-wusstsein erschüttert, gestürzt: «Wer bin ich? Wer bin
ich, dass ich diesen Auftrag erfüllen kann?»
Auch heute noch ermahnt Petrus seine Brüder, bestärkt sie im Glauben,
dass die ein-zige Antwort auf diesen Zweifel, die einzige Antwort,
die Trost und Kraft spendet, von Gott selbst kommt: «Ich bin mit dir!»
Die Antwort des Mensch gewordenen Gottes, der für uns gestorben und
auferstanden ist, ist heute noch entschiedener und enga-gierter, wie
auch der Auftrag weltumfassend geworden ist: «Mir ist alle Macht gege-ben
im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern … und lehrt
sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe… Ich bin bei euch
alle Tage bis zum Ende der Welt!» (Mt 28,18-20).
Dieses «Ich bin bei dir!» ist die Antwort Gottes auf die Frage jedes
Christen, wie er seine Sendung in der Kirche und in der Welt von heute
erfüllen kann, sei er Hirte o-der einfacher Gläubiger. Diese Antwort
durchzieht alle Worte, die der Heilige Vater an die Schweizer Bischöfe
gerichtet hat.
In diesem Licht können wir die eindringliche Ermahnung des Papstes
zum Gebet ver-stehen und aufnehmen: «Wichtig ist vor allem, die persönliche
Beziehung zu Gott zu pflegen, zu dem Gott, der sich uns in Christus
gezeigt hat» (Ansprache zum Abschluss des Besuches, 9. November 2006).
Wenn die Sendung der Kirche schwieriger wird, in Zeiten und Situationen,
in wel-chen die Kirche vermehrt angefeindet wird, in welchen menschliche
Schwäche und Unzulänglichkeit offensichtlicher werden, ist der Christ
und vor allem der Hirte un-vermeidlich von der Versuchung bedroht,
die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Auferstandenen zu vergessen,
dessen sichtbares Zeichen und Instrument die Kirche ist. Wir vergessen
und vernachlässigen die Tatsache, dass Gott bei uns bleibt. Wir verstricken
uns (das vor allem!) in der quälenden Frage des Mose: «Wer bin ich?
Wer sind wir?» und wir sind nicht mehr fähig die tröstliche Antwort
Gottes zu hören: «Ich bin mit dir!»
Wir müssen diese Antwort Gottes wahrnehmen, diese wesentliche, einzig
notwendige Antwort, die der Papst unseren Bischöfen und durch sie
uns in Erinnerung rufen wollte. Denn diese Antwort ist unsere Identität,
gibt uns unsere Identität. Diese Ant-wort lässt den Menschen verstehen,
wer er ist, welches sein Wesen ist, worin das Ge-heimnis seines Herzens
besteht. Nur wenn der Mensch auf seine Frage «Wer bin ich?» die Antwort
Gottes annimmt, wird er fähig «ich» zu sagen, wird er fähig sich als
jemand zu erkennen, dem Gott mit dem Leben eine besondere Berufung
und Sen-dung mitgegeben hat.
Es lohnt sich, die wichtigsten Punkte der Ermahnung unseres Heiligen
Vaters zum Gebet hervorzuheben und deren Verknüpfung aufzuzeigen.
Am
Anfang steht eine völlig unverdiente Einladung
Lesen wir zu Beginn einen
Abschnitt aus dem Evangelium, welchen der Papst in sei-ner Predigt
zur Eröffnung des Ad-limina-Besuches auslegte:
«Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein.
Als das Fest be-ginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ
den Gästen, die er eingeladen hatte, sagen: Kommt, es ist alles bereit!
Aber einer nach dem andern ließ sich entschuldi-gen. Der erste ließ
ihm sagen: Ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt gehen und ihn
besichtigen. Bitte, entschuldige mich! Ein anderer sagte: Ich habe
fünf Ochsenge-spanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genauer
anzusehen. Bitte, entschuldige mich! Wieder ein anderer sagte: Ich
habe geheiratet und kann deshalb nicht kom-men. Der Diener kehrte
zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig
und sagte zu seinem Diener: Geh schnell auf die Straßen und Gassen
der Stadt und hol die Armen und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen
herbei» (Lk 14,16-21).
Zuerst muss unterstrichen werden, dass das Gebet als persönliche Beziehung
zu Gott immer eine Antwort auf die unverdiente Initiative des Herrn
ist. Alles geht von dieser Initiative aus; Gott ist es, der dem Menschen
seine Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Freundschaft schenkt. Die
Einladung, die der Herr des Festmahles an die Rei-chen und Armen richtet,
ist völlig unverdient. Diese schickten sich an, ihre Arbeit auf dem
Feld zu verrichten, Handel zu treiben, mit ihren Ochsen zu pflügen,
sich mit ih-rer Braut zu unterhalten; oder sie waren dabei, am Wegrand
um ein Stück Brot zu betteln, die Aufmerksamkeit auf ihr Gebrechen
zu ziehen, sich auf der Straße voran-zutasten; vielleicht verfluchten
sie gerade ihr Schicksal, das ihnen Armut und Krank-heit auferlegte,
als sie die völlig unerwartete Einladung des Herrn überfiel: «Kommt
mit mir essen! Kommt mit mir eine Stunde der Gemeinschaft, der Freundschaft
zu verbringen!»
Verglichen mit den Reichen und Mächtigen haben die Armen und Unglücklichen
im Angesicht dieser überraschenden und unverdienten Einladung einen
Vorteil: Sie ha-ben nichts zu verteidigen, nichts Wichtigeres zu tun
in diesem Augenblick. In ihrer desperaten Situation können sie besser
als andere die Unverhältnismäßigkeit und den Wert dessen ermessen,
wozu der Herr sie einlädt.
Gerade diese Grundlosigkeit, mit der Gott dem Menschen seine grenzenlose
Freund-schaft anbietet, scheitert nie. Selbst wenn der Festsaal, den
Gott mit Gästen füllen will, leer bleibt, «Gott scheitert nicht»,
sagt der Papst, denn «der leere Saal wird zur Möglichkeit, mehr Menschen
zu rufen. Gottes Liebe, Gottes Einladung weitet sich aus» (Predigt
vom 7. November 2000).
Gott schließt den unendlichen Raum der Gemeinschaft mit ihm nicht.
Daher ist die persönliche Beziehung zum Herrn im Gebet immer möglich,
sie kann immer wieder aufgenommen und erneuert werden.
Die
verschmähte Einladung
Die Grundlosigkeit der
Einladung offenbart das eigentliche Wesen der Ablehnung: die Verkennung,
die Unterschätzung des Angebots. Alle Personen des Gleichnisses bringen
für die Ablehnung der Einladung Gründe vor, die mit dem täglichen
Leben jedes Menschen zu tun haben: das Feld, fünf Ochsengespanne,
die Hochzeit, kurz: die Güter, die wir besitzen, unsere Arbeit, die
Beziehungen, die unser Leben bestimmen.
Dabei handelt es sich in diesem Gleichnis nicht um den Ruf, alles
zu verlassen, das Feld, die Arbeit, die eigene Familie, und dem Herrn
zu folgen, um das Hundertfache und das ewige Leben zu erlangen. Diese
Menschen sind einfach eingeladen, zu jenem Herrn, zu seinem Festmahl
zu gehen. Kann man denn die Besichtigung des erworbe-nen Feldes nicht
um ein paar Stunden verschieben? Können die Ochsengespanne nicht noch
etwas warten, bevor sie ausprobiert werden? Kann die junge Frau, die
e-ben geheiratet hat, nicht für ein paar wenige Stunden allein bleiben,
wo ja das ganze Eheleben vor ihr liegt? Warum schlagen diese Menschen
die Einladung aus? Ihre Entschuldigungen halten nicht stand: Keiner
der Gründe ist zwingend, keiner ist eine echte Alternative zum Festessen,
das der Herr anbietet.
Der eigentliche Grund für die Ablehnung ist die Unterschätzung, die
geringe Bedeu-tung, die der Einladung und damit auch der Person, die
einlädt, beigemessen wird. Wenn die Geladenen keine Bedenken haben,
die Einladung abzulehnen, will das hei-ßen, dass dieser Herr für sie
gar nicht wichtig ist, dass er kein König oder Hausherr von Bedeutung
ist. Und somit erkennen wir, dass der einzige Grund für die Annahme
der Einladung die Freundschaft dieses Herrn wäre. Er lädt allein aus
Freundschaft zum Festmahl ein, weil er will, dass diese Freundschaft
sich vertieft. Es ist diese Freundschaft, welche die Geladenen ausschlagen,
es ist diese Freundschaft, welche sie nicht zu schätzen wissen.
Der Papst weist in seiner Predigt darauf hin, dass die Verkennung
der grundlosen Freundschaft Gottes eigentlich das Wesen der Erbsünde
ist, das Tor, durch das Adam das Böse in sein Leben und in die ganze
Menschheitsgeschichte eindringen ließ: «A-dam war mit der Freundschaft
Gottes nicht zufrieden; es war ihm zu wenig, er wollte selbst ein
Gott sein. Er sah Freundschaft als Abhängigkeit an und hielt sich
für einen Gott, wenn er nur in sich selber stand.»
Diejenigen, welche die Einladung zum Festmahl des Herrn ausschlagen,
gleiten in diese absurde Logik ab, indem sie den Anspruch erheben
«in sich selber zu stehen», indem sie glauben, nicht auf Gott und
seine Freundschaft angewiesen zu sein, um ihr alltägliches Leben menschlicher,
schöner, wahrhaftiger und heller werden zu lassen.
Die Geladenen, die mit nichtigen Begründungen die Einladung des Herrn
ausschla-gen, sind ein perfektes Bild für den Menschen unserer Zeit,
für den Menschen der abendländischen, entchristlichten Gesellschaft.
Es geht hier wohl nicht mehr um eine überlegte Ablehnung, die einer
andern religiösen oder philosophischen Überzeugung entspringt. Es
handelt sich vielmehr um den Verlust des Bewusstseins, welche Bedeu-tung
der Beziehung mit Gott im Leben des Menschen zukommt.
«Wie ist es möglich», fragt sich der Papst mit Gregor dem Großen,
«wie ist es mög-lich, dass der Mensch zu dem Größten ‚nein’ sagt,
für das Wichtigste keine Zeit hat, seine Existenz in sich verschließt?»
Die Antwort des Papstes entlastet in einem gewissen Sinn den Menschen
unserer Zeit und beschreibt dessen innere Armut: «Sie haben eben nie
die Erfahrung Gottes ge-macht, sind nie auf den Geschmack Gottes gekommen;
sie haben nie gespürt, wie köstlich es ist, von Gott angerührt zu
werden! Diese ‚Berührung’ – und damit ‚der Geschmack an Gott’ – fehlt
ihnen.»
Die Not des Menschen unserer Zeit besteht darin, dass er Gott ablehnt,
ohne ihn zu kennen. Die Gäste, welche die Einladung ausschlagen, um
etwas anderes zu machen, etwas anderes zu erleben, sind somit ein
Gleichnis für unsere Gesellschaft, in welcher die von Gott angebotene
Freundschaft die Realität des alltäglichen Lebens nicht mehr erreicht,
keine Bedeutung mehr hat für das, was der Mensch besitzt, für seine
Arbeit, sein Gefühlsleben, sein Familienleben. Der Mensch sieht und
glaubt nicht mehr, dass die Freundschaft mit Gott sein Leben positiv
beeinflussen, dass sie eine Erfüllung in die Wirklichkeit des Alltags
bringen würde, die dieses Leben menschlicher und lichter werden ließe.
Dieses Gleichnis beschreibt auch das Wesen der großen Krise, die das
abendländische Christentum erschüttert, der Krise der europäischen
und nordamerikanischen Län-der, der Krise, welche die Kirchen geleert,
das Leben vieler Pfarreien in der Form er-starren und steril werden
ließ, welche so viele Institutionen der Erziehung, des kari-tativen
Wirkens und des kulturellen Lebens laisiert hat, Einrichtungen, welche
die Kirche in der Vergangenheit mit unermüdlichem Einsatz gegründet
und belebt hat. Die Krise besteht nicht in erster Linie darin, dass
statistisch gesehen weniger prakti-ziert und weniger für die Kirche
getan wird. Das ist bloß eine Folge. Die Krise besteht darin, dass
Jesus Christus nicht mehr als der wahrgenommen wird, der unser wirkli-ches
Leben, das alltägliche Leben rettet und heil macht. Und wenn die Kirchen
leer werden, zeigt das vielleicht, dass die Krise bereits vorhanden
war, als sie noch voll waren, weil man nicht mehr erkannte, wie der
Messbesuch, die Heiligung des Sonn-tags, die Beteiligung an kirchlichen
Anlässen, die Mitarbeit in katholischen Vereinen sich vorteilhaft
auswirkte auf das Leben der Gläubigen, das Leben besser, intensiver,
menschlicher, glücklicher zu machen vermochte. Diese Praxis war bereits
nicht mehr die gelebte und immer neue Erfahrung des Heilswirkens Christi,
der den Menschen hier und jetzt erlöst.
Der Papst untersucht diese Situation und hilft uns, ihr ins Auge zu
blicken. Er zeigt auf, wie sie von ihrer Wurzel her nicht eine Krise
der Struktur, sondern eine Krise des Glaubens und der inneren Erfahrung
ist und die Schwäche unseres Herzens offen-bart. Diese Krise betrifft
uns alle nach und nach. In einem Abschnitt seiner Predigt beschreibt
der Papst sie als eine Art Herzatrophie. Das Herz der Krise des modernen
Menschen ist die Krise seines Herzens, die Krise des menschlichen
Herzens, das die Fähigkeit der Freundschaft mit Gott verliert: «Wenn
der Mensch ganz mit seiner ei-genen Welt beschäftigt ist, mit den
materiellen Dingen, mit dem, was er tun und ma-chen kann, mit allem
Machbaren, das ihm Erfolg bringt, das er selber hervorbringen und
aus sich einbeziehen kann, dann verkümmert seine Empfindungsfähigkeit
Gott gegenüber, das Organ für Gott verkümmert und er wird stumpf und
unsensibel für ihn. Er spürt das Göttliche nicht mehr, weil das Organ
in ihm vertrocknet ist, sich nicht mehr entfaltet hat. Wenn er zu
sehr all die anderen Organe gebraucht, die em-pirischen, dann kann
es geschehen, dass eben der Sinn für Gott verflacht, dieses Or-gan
abstirbt und der Mensch, wie Gregor sagt, das Anschauen, das Angeschautwer-den
von Gott nicht mehr empfindet – dieses Kostbare, dass sein Blick mich
trifft!» (Predigt vom 7. November 2006).
Der Mensch unserer Zeit hat sozusagen den Geschmack an Gott verloren,
und mit diesem Verlust verliert er seine tiefste Dimension, verliert
er sein Herz, das danach hungert das Antlitz Gottes zu sehen, sich
von Seinem Blick faszinieren zu lassen.
Der
Weg der Erneuerung: bei der Erfahrung Gottes anfangen
Wie kann diese Krise,
die den Menschen gegenüber der Gotteserfahrung immun ge-macht hat,
überwunden werden? Wie kann die Überzeugung, dass Gott allein das
Herz des Menschen und der Menschheit mit neuem Leben zu erfüllen vermag,
ge-weckt werden?
Benedikt XVI. zeigt einen im Grunde sehr einfachen Weg auf, ein Weg,
der die Schwachheit und Schuld des Menschen nicht übergeht: Wir können
den Neuanfang nicht von uns aus schaffen, von dem aus, was wir sind
und tun, von dem aus, was wir denken und empfinden. Ein Neubeginn
ist nur von Gott her möglich. Wir können mit Ihm neu anfangen, so
wie Er mit uns nach jedem Scheitern seines Heilsangebotes neu anfängt.
«Gott scheitert nicht», sagt uns Benedikt XVI. Er scheitert nicht,
weil er immer neu anfängt, den Menschen zu lieben. Es ist unumgänglich,
von ihm her neu zu beginnen und so neu zu beginnen, wie Er es tut:
Er erneuert, vertieft und erweitert ständig das Angebot seiner Liebe,
seiner Freundschaft. Die Bedingungslosigkeit der ständig er-neuerten
Liebe Gottes offenbart sich in besonderem Maß gegenüber der Ablehnung
und Missachtung, die der Mensch ihm entgegenbringt. Und gerade diese
Erfahrung ruft den Menschen eindringlich dazu auf, nun seinerseits
sich dieser Liebe bedin-gungslos zu öffnen. Er kann das aber nur im
Bewusstsein seiner Bedürftigkeit, im Bewusstsein, dass er diese Liebe
nicht verdienen kann.
Daher kann Gott nur mit dem bedürftigen Herzen neu beginnen, kann
er nur dem Notleidenden das abgewiesene Angebot seiner Freundschaft
erneuern. Gott macht einen Neuanfang mit den Ärmsten, weil jeder Neuanfang
allein seinem Erbarmen entspringt, und mit seinem Erbarmen holt er
alles ein. Es ist diese Barmherzigkeit, die nie scheitert, die Barmherzigkeit,
die sich im gekreuzigten Christus restlos offen-bart hat. Die Liebe
Gottes, die in der Ablehnung des Menschen scheitert, siegt im Er-lösungstod
Christi. «Durch das Kreuz Christi ist Gott zu den Völkern gekommen,
aus Israel hinausgegangen, der Gott der Welt geworden. (...) Der Gott,
der ‚gescheitert’ war, bringt nun durch seine Liebe den Menschen wirklich
dazu, die Knie zu beugen, und überwindet so die Welt mit seiner Liebe»
(Predigt vom 7. November 2006).
Das Erbarmen Gottes verwandelt auf diese Weise die Leere, die der
Mensch mit sei-ner Verweigerung schafft. «Der leere Saal wird zur
Möglichkeit, mehr Menschen zu rufen. Gottes Liebe, Gottes Einladung
weitet sich aus (...) Er lädt die ein, die nichts besitzen; die wirklich
Hunger haben, die ihn nicht einladen, ihm nichts geben kön-nen» (Predigt
vom 7. November 2007).
Ja, betont der Papst, «Gott scheitert nicht. Er ‚scheitert’ ständig,
aber gerade darum scheitert er nicht, denn er macht daraus neue Möglichkeiten
größeren Erbarmens, und seine Phantasie ist unerschöpflich. Er scheitert
nicht, weil er immer neue Weisen findet, zu den Menschen zu gehen
und sein großes Haus weiter zu öffnen, dass es ganz voll werde. Er
scheitert nicht, weil er nicht davor zurückschreckt, die Menschen
zu drängen, dass sie kommen und sich an seinen Tisch setzen sollen,
das Mahl der Armen einzunehmen, in dem die köstliche Gabe, Gott selbst,
geschenkt wird. Gott scheitert nicht, auch heute nicht. Selbst, wenn
wir so viel Nein erleben, dürfen wir es wissen. Aus dieser ganzen
Gottesgeschichte, von Adam an, können wir erkennen: Er scheitert nicht.
Auch heute wird er neue Wege finden, Menschen zu rufen, und möch-te
uns als seine Boten und Diener dabei haben.»
Wir jammern viel über den Zustand unserer Kirche. Die zunehmende Leere
betrübt und deprimiert uns. Der Papst lädt uns ein den Blick zu heben,
mit den Augen des Glaubens zu sehen, uns immer wieder den Herrn und
sein Handeln in Erinnerung zu rufen. Wir sind wie das Volk Israel
in der Wüste: Wir vergessen schnell die Wunder-taten des Herrn, und
deshalb verlieren wir unser Vertrauen zu ihm. Wir klammern uns an
das Vertrauen, das wir in uns selbst setzen, und damit an eine Illusion.
Papst Benedikt XVI. aber lädt uns dazu ein, gerade diese deprimierende
Leere als Raum der Hoffnung zu sehen und zu leben. Wie das? Im Gebet,
indem wir diesen Raum füllen mit der Beziehung zu Gott, mit der Erfahrung
Gottes. Ist es nicht gerade das, was Je-sus immer getan und gelebt
hat, wenn er in der Wüste und in der Nacht betete, bis in die innere
völlige Verlassenheit im Garten des Ölbergs und am Kreuz?
Der Papst konzentriert unsere ganze Verantwortung, den Einsatz unserer
Freiheit in der Entscheidung, uns völlig in die persönliche Beziehung
zum Herrn hinein zu ge-ben. Das allein wird unseren leeren Saal füllen,
denn es ist nicht in erster Linie die Zahl der Leute als vielmehr
die Bereitschaft, den unter uns lebenden Herrn aufzu-nehmen, die die
Vitalität der Kirche ausmacht. Es ist, als würde der Papst noch ein-mal
hören, wie Jesus zu seinen Jüngern sprach: «Weiter sage ich euch:
Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie
von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen» (Mt 18,19-20).
Ja, es tut nichts zur Sache, wenn wir nur wenige, sehr wenige sind.
Nicht die Zahl ist wichtig, sondern dass die Wenigen im Gebet, im
Namen Jesu vereint bleiben; dass die persönliche Beziehung zu Christus
die Leere füllt, die Kleinheit und Schwäche unserer Gemeinschaft und
unserer Person.
Benedikt XVI. betont die Bedeutung des Gebetes und damit die zentrale
Stelle Gottes als immer neu angebotene «Lösung» des Problems, das
im Elend des Menschen und der Welt besteht. Der Papst beharrt nicht
auf einer Praxis, sondern auf der Beziehung zu einer Person. Denn
wenn es der Welt schlecht geht, wenn es dem Menschen schlecht geht,
wenn selbst die Kirche in der Krise zu sein scheint, dann fehlt uns
nicht etwas, dann fehlt uns nicht ein besseres Programm, dann fehlt
uns Gott. Dann fehlt uns der Herr. Dann fehlt uns Christus.
Der Aktivismus und ganz besonders der kirchliche Aktivismus offenbart
uns, dass wir diese zentrale Wahrheit vergessen haben. «Denn die Gefahr
besteht ja auch für uns: Man kann ganz viel tun, Kirchliches tun,
alles für Gott tun…, und dabei bleibt man ganz bei sich selber und
kommt Gott gar nicht über den Weg» (Predigt vom 7. November 2006).
Gott ins Zentrum stellen bedeutet vor allem, das Bewusstsein pflegen
und ausdrü-cken, dass Er unverzichtbar ist, dass wir ohne Ihn nichts
tun können (Joh 15,5). Das Gebet ist somit wie das Einatmen der Luft,
der angemessenste Ausdruck, die einzige Antwort auf unseren Hunger:
die Gegenwart des lebendigen Gottes, der uns rettet.
«Es geht um die Zentralität Gottes, – sagt der Papst zum Abschluss
seiner Predigt – und zwar nicht irgendeines Gottes, sondern des Gottes
mit dem Gesicht Jesu Christi. Das ist heute wichtig. Es gibt so viele
Probleme, die man auflisten kann, die alle ge-löst werden müssen,
die aber alle nicht gelöst werden, wenn nicht im Zentrum Gott steht,
neu sichtbar wird in der Welt, maßgebend ist in unserem Leben und
durch uns auch maßgebend in die Welt hineinritt. Daran, denke ich,
entscheidet sich heute das Geschick der Welt in dieser dramatischen
Situation: ob Gott da ist ‚der Gott Jesu Christi – und anerkannt wird,
oder ob er verschwindet. Um seine Gegenwart mühen wir uns. Was sollen
wir tun? Zuletzt? Wir rufen zu ihm!»
Beten
lernen und lehren
Der Papst will die Bischöfen
und alle Gläubigen ganz einfach an das das Wichtigste erinnern: wir
müssen beten lernen. Wir müssen beten lernen, damit wir im Gebet unterweisen
können; das heißt nicht Lektionen über das Gebet erteilen, sondern
die Erfahrung weitergeben, dass die lebendige Beziehung zu Gott die
Substanz und Fülle des Christentums ist. Darauf insistiert der Heilige
Vater in der Ansprache, die er zum Abschluss des Ad-limina-Besuches
gehalten hat. Er ermahnt dazu, nicht mehr die ganze Energie auf Diskussionen
zu verschwenden: «Wir sollten unseren Glauben nicht durch vielfältige
Einzelheiten zerreden lassen», denn so lassen wir uns einfan-gen in
das Spiel, das die Kirche auf eine Institution mit «ein paar Ge- und
Verboten» reduzieren will. Die Kirche ist nicht da, um eine Moral
oder eine Philosophie zu ver-teidigen, sondern um einen Gott zu vergegenwärtigen
und zu verkündigen, der Mensch gewordenen, gestorben und auferstanden
ist, um uns zu erlösen, der unter uns lebt und bei uns bleibt bis
ans Ende der Zeiten. Das ist «die Größe unseres Glau-bens». Die Größe
des christlichen Glaubens ist die allen Menschen angebotene Erfah-rung
des Ereignisses, das Christus heißt.
Auf diese Überzeugung stützt sich Benedikt XVI., wenn er uns die pastorale
und mis-sionarische Tragweite des gelebten Gebetes in Erinnerung ruft.
Es geht nicht in erster Linie darum zu beten, dass das Christentum
sich behaupten und ausbreiten kann, sondern darum, dass das Christus-Ereignis
das Ereignis unseres Lebens wird. Die Sendung der Kirche besteht nicht
vorrangig darin etwas Bestimmtes zu tun, sondern ein neues Geschöpf
zu sein, ein Geschöpf, welches in das Christus-Ereignis hineinge-nommen
ist.
Wie lernt man beten?
So wie man eine Freundschaft vertieft. Das geschieht, indem man den
Austausch von Worten und die Bindung zwischen den Personen immer intensiver
werden lässt. Eine Beziehung vertieft sich im Dialog, wenn der Dialog
ein Wechsel und ein Austausch von Hören und Sprechen, von Schweigen
und Sprechen, von zuhörendem Schweigen und vertrauendem Sprechen ist.
Damit aber ein Zwiegespräch nicht in einer ober-flächlichen Gegenüberstellung
von Ideen und Meinungen hängen bleibt, muss es den Austausch der Liebe
vertiefen, das heißt die Aufmerksamkeit des Herzens und die gegenseitige
Hingabe. Und genau so lernt man auch immer besser beten, darauf weist
der Papst hin: indem man das Zwiegespräch mit Gott und die liebende
Hingabe ver-tieft.
Diese Methode hat nicht der Mensch erfunden; sie ist von der göttlichen
Natur be-stimmt. Der Papst erinnert uns daran, dass Gott Logos und
Amor ist, wie der heilige Augustinus betont. Gott ist Wort und Liebe,
und deshalb kann die Beziehung zu ihm nur im liebenden Zwiegespräch
bestehen. Das Gebet ist liebendes Zwiegespräch mit Gott. In diesem
Dialog ist Raum für jegliche Form des Betens: das Schweigen, das Hören,
das Anbeten, das Bitten, das Lob, der Jubel …
Das Wesen Gottes bestimmt das Wesen unserer Beziehung zu ihm. In Christus
hat Gott sich dem Menschen als Logos und Amor zu erkennen gegeben.
Daher hat das christliche Gebet eine unübertreffliche Einzigartigkeit.
Es gibt keine engere Bezie-hung zu Gott als das christliche Gebet,
weil Gott sich in Jesus Christus der Bezie-hungsfähigkeit, die Er
selber ins Herz eines jeden Menschen gelegt hat, restlos geöff-net
hat. «Die letzte und eigentliche Größe unseres Gottesbegriffs», schreibt
der Papst, ist Christus. «Gott ist Spiritus Creator, ist Logos, ist
Vernunft. Und diese Vernunft hat ein Herz, so sehr, dass sie auf ihre
Unermesslichkeit verzichten kann und Fleisch annimmt». Deshalb entspricht
das Gebet als liebende Beziehung zu Gott der Größe des Christentums.
Daran erinnert uns der Heilige Vater mit Nachdruck. Er tut dies aber
auch, um uns aufzurütteln in unserer Zerstreutheit und Nachlässigkeit,
mit der wir oft den Glauben leben. Diese Oberflächlichkeit besteht
vor allem darin, dass wir den Reichtum des Gebetes, des persönlichen
Kontaktes mit Gott, wie er uns im fleischgewordenen Wort geschenkt
ist, übersehen. Das Gebet ist nicht einfach irgendeine zweckmäßige
Hand-lung, es ist nicht eine Verlegenheitslösung, eine Notlösung,
um Gott herbeizurufen, wenn wir unsere Ohnmacht spüren. Das Gebet
ist das Herz und das Zentrum der christlichen Erfahrung. Ohne dieses
Herz fällt die christliche Erfahrung in sich zu-sammen, ist sie sinnentleert,
ohne Substanz, und somit können die Probleme, mit denen wir in unserer
christlichen Gemeinschaft konfrontiert sind, die wirklichen und schwierigen
Probleme, nur oberflächlich angegangen werden. «Dieses innere Sein
bei Gott und dadurch Erfahren der Gegenwart Gottes ist das, was sozusagen
immer wie-der die Größe des Christentums spüren lässt und uns dann
auch durch all das Kleine hindurchhilft, in dem es freilich gelebt
und Tag um Tag leidend und liebend, in Freu-de und Trauer, Wirklichkeit
werden muss» (Ansprache zum Abschluss des Besuches, 9. November 2006).
Das Gemeinschaftsleben, die Liturgie, die christliche Erziehung, alles
das ist uns gegeben, damit die Begegnung mit Christus in unserem Leben
Wirklichkeit wird. Das Konzil hat uns in Erinnerung gerufen, dass
das Wesen der Kirche «Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für
die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit»
ist (Lumen gentium 1). Wenn diese «innigsten Vereinigung mit Gott»
nicht persönliche Erfahrung wird, Erfahrung des Herzens, dann würde
das ganze kirchliche Leben einer Person oder einer Gemeinschaft seinen
Sinn verlieren, es würde steril.
Der Papst fordert uns auf, gegen diese Oberflächlichkeit anzugehen.
Er fordert das vor allem von den Hirten, damit die Gläubigen ihnen
folgen und selber davon Zeug-nis ablegen, dass ein Leben in persönlicher
Beziehung zu Gott immer möglich ist: «Deshalb ist es eine Grundaufgabe
der Pastoral, beten zu lehren und es selber immer mehr zu lernen.
Schulen des Gebets, Gebetskreise, gibt es heutzutage; man sieht, dass
Menschen das wollen. Viele suchen Meditation irgendwo anders, weil
sie die spiritu-elle Dimension im Christentum nicht zu finden glauben.
Wir müssen ihnen wieder zeigen, dass es diese spirituelle Dimension
nicht nur gibt, sondern dass sie die Quelle von allem ist» (Ansprache
zum Abschluss des Besuches, 9. November 2006).
Der Papst spricht vom Lernen und Lehren, er spricht davon, dass diese
persönliche Beziehung zu Gott gepflegt und vorgelebt werden muss.
Er spricht von den «Schulen des Gebets». Wenn das Gebet eine vergessene
und vernachlässigte Dimension unse-res Lebens geworden ist, dann müssen
wir wieder dazu hingeführt werden. Die Men-schen spüren dieses Bedürfnis
und drücken es auf ihre Art aus, aber oft finden sie in der Kirche
keine Hilfe. Es ist daher notwendig, dass sie Personen und Gemeinschaf-ten
begegnen, dass ihnen Orte und Zeiten zur Verfügung stehen, wo diese
Erfahrung mitgeteilt wird, wo sie davon berührt und getragen werden.
«Dazu müssen wir ver-mehrt solche Schulen des Gebetes, des Miteinander-Betens,
bilden, wo man das per-sönliche Beten in all seinen Dimensionen lernen
kann: als schweigendes Hinhören auf Gott, als Hineinhören in sein
Wort, in sein Schweigen, in sein Tun in der Ge-schichte und an mir;
auch seine Sprache in meinem Leben verstehen und dann ant-worten lernen
im Mitbeten mit den großen Gebeten der Psalmen des Alten und des Neuen
Testaments. Wir haben selber nicht die Worte für Gott, aber Worte
sind uns geschenkt: Der Heilige Geist hat selber für uns schon Gebetsworte
geformt; wir kön-nen hineintreten, mitbeten und darin dann auch das
persönliche Beten lernen, Gott immer mehr ‚erlernen’ und so Gottes
gewiss werden, auch wenn er schweigt – Gottes froh werden» (Ansprache
zum Abschluss des Besuches, 9. November 2006).
Eine solche Schule gibt es schon seit je: die Schule der Liturgie.
Wenn die Liturgie gelebt würde, um das Beten zu lernen, wie viele
Missbräuche würden augenblicklich aus den Gottesdiensten verschwinden!
Die Liturgie würde gelebt mit der demütigen Absicht, mit der Sehnsucht
zu lernen, zu hören, zu bitten, der Kirche zu folgen, die seit zweitausend
Jahren ihre Gläubigen bei der Hand und wenn nötig beim Arm nimmt,
um sie das Zwiegespräch mit Gott zu lehren, der lebendiges Wort und
Liebe ist. Wir würden entdecken, dass man nur mit der Schönheit und
Wahrheit lernt. Die Liturgie ist «eben auch Schule des Betens, in
der der Herr selbst uns beten lehrt, in der wir mit der Kirche beten,
sowohl in der einfachen, demütigen Feier, in der nur ein paar Gläubige
sind, als auch im Fest des Glaubens» (Ansprache zum Abschluss des
Besuches, 9. November 2006).
Für
ein frohes Christentum: die Hoffnung
Ein solches «Netz von
Schulen», das den Bedürfnissen entspricht, kann nicht impro-visiert
werden. Aber der Heilige Vater hilft uns wenigstens zu verstehen,
dass das ei-ne Priorität sein muss, dass alle andern Unternehmungen
zur Erneuerung der christ-lichen Gemeinschaft, und das heißt der wirklich
menschlichen Gemeinschaft, in der Gesellschaft unserer Zeit nur eine
Folge sein können, eine Konsequenz dieser geistli-chen «Bewässerung».
Von da wird ein neues Christentum geboren werden, ein frohes Christentum,
ein Christentum von Männern und Frauen, die ihre Freude aus Gott schöpfen.
Denn Menschen, die mit nichts und niemandem zufrieden sind, die nur
fordern und nichts anbieten, können der Welt nicht die Größe und Schönheit
eines Lebens mit Christus mitteilen.
Was Papst Benedikt XVI. in seinen Ansprachen den Schweizer Bischöfen
gegeben hat, ist nichts anderes als ein persönliches Zeugnis, die
Frucht der Erfahrung seines ganzen Lebens, das der Liebe zu Christus
und der Kirche geweiht war. Beim Lesen dieser Ansprachen verstehen
wir das Geheimnis der Freude und des Friedens, womit der Heilige Vater
das Schiff der Kirche heute in den Strömungen und Klippen, die ihn
ängstigen und zur Flucht verleiten müssten, vorwärts steuert. Er hingegen
lässt sich heute noch von der Stimme des Herrn berühren, die vor zweitausend
Jahren zu Pet-rus sagte: «Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch
nicht!» (Mt 14,27). Es ist, als möchte er davon Zeugnis ablegen, dass
ihn diese Stimme gerade im Gebet erreicht, und dass hier die Quelle
seines Friedens und seiner Freude zu finden ist, mit der er seine
Mitbrüder, die Bischöfe, und das ganze Volk stärkt.
Der eigentliche Name dieser Freude ist die Hoffnung. Darauf macht
uns der Papst aufmerksam, wenn er auf Thomas von Aquin verweist, der
«Hoffnung und Gebet so-zusagen miteinander identifiziert. (...) Das
Gebet ist Hoffnung in Akt. Und in der Tat, im Gebet öffnet sich der
eigentliche Grund, warum wir hoffen dürfen: Wir können mit dem Herrn
der Welt in Berührung treten, er hört uns zu, und wir können ihm zuhören.
(...) Das eigentlich Große des Christentums, das uns nicht dispensiert
vom Kleinen und Alltäglichen, das aber auch davon nicht verdeckt werden
darf, ist diese Möglichkeit, mit Gott in Berührung zu treten» (Ansprache
zum Abschluss des Besu-ches, 9. November 2006).
Die Frucht des Gebetes, in welchem wir tatsächlich dem Herrn der Welt
begegnen, ist ein Mensch der Hoffnung. Die Hoffnung ist die Tugend,
die alles verwandelt, weil sie die Haltung des Herzens, seinen Blickwinkel
verändert. Die Frucht des Gebetes ist ein Mensch, der im Vertrauen
auf Gott lebt, weil er der Freundschaft Gottes gewiss ist. Diese Umkehr
des Herzens zur Hoffnung verwandelt alles, denn die Hoffnung übergibt
alles vertrauend dem Allmächtigen.
Kehren wir noch einmal zum Gleichnis des Gastmahles zurück, das der
Papst in sei-ner Predigt den Schweizer Bischöfen ausgelegt hat. Was
hat sich im Leben der Ar-men, der Krüppel, der Blinden, der Lahmen,
welche die Einladung angenommen hat-ten, verändert? Scheinbar nichts.
Nach dem Festmahl sind sie in ihr Leben zurückge-kehrt, immer noch
arm, verkrüppelt, blind, lahm, wie vor der Einladung, außer dass sie
für einmal genug gegessen hatten. Aber sie haben die Freundschaft
des Herrn empfangen, und im Bewusstsein, dass sie Freunde des Herrn
sind, konnten sie ihr gewöhnliches Leben weiterführen, obwohl es ein
mühsames, armseliges Leben war. Es hat sich also nichts verändert;
und doch hat sich alles verändert. Sie konnten wei-terleben mit dem
Bewusstsein, dass sie geliebt sind, dass sie in den Augen des Herrn,
der sie eingeladen, der mit ihnen gegessen und getrunken, sich mit
ihnen unterhalten hat, dass sie in dessen Augen wertvoll, bedeutungsvoll
sind. Paradoxerweise hat ge-rade ihr Elend die Liebe des Herrn, seine
Freundschaft offensichtlich werden lassen. Dass der Herr ihr Freund,
die meist geliebte, wichtigste Person der Erde ist, war für sie von
nun an zu einem nicht verblassenden Erlebnis geworden, das in ihrem
Herzen keinem Widerspruch, keinem Zweifel ausgesetzt werden konnte.
Die Evangelisierung der Kirche ereignet sich durch solche Menschen,
deren Freude in der gelebten Beziehung zu Christus besteht. Es spielt
keine Rolle, ob sie armselige Sünder sind wie Zachäus, wie die Samariterin,
wie auch die Apostel. Es geht nicht darum, bessere Menschen zu sein,
sondern Menschen, die von der Freundschaft mit Christus berührt sind,
Menschen, die, wie ein Satz aus der Regel des heiligen Bene-dikt sagt,
«der Liebe Christi nichts vorziehen» (Regel 4,21), Menschen, für die
die Liebe Christi alles ist. Petrus hat Jesus verleugnet, aber keinen
Augenblick lang har er in seinem Herzen die Freundschaft Christi verachtet.
Heute hat Petrus wieder zu uns gesprochen, und im Grunde hat er, wie
ein Echo, die einzige Forderung des Auferstandenen wiedergegeben,
die einzige Forderung, die einen Hirten ausmacht, der des Herrn würdig
und für die Menschheit fruchtbar ist: «Simon, Sohn des Johannes, liebst
du mich?» (Joh 21,16).
Das Gebet ist der Ausdruck der Sehnsucht, auf diese Frage des Herrn
immer mit «ja» zu antworten.
|